Seit Monaten versuchen Jurist/innen und Politiker/innen den Umbau der unabhängigen Justiz in Polen zu stoppen. Nun hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil gefällt, wonach die Auslieferung eines Verdächtigen von Irland an Polen verweigert werden kann, wenn ihm dort kein faires Verfahren garantiert ist.
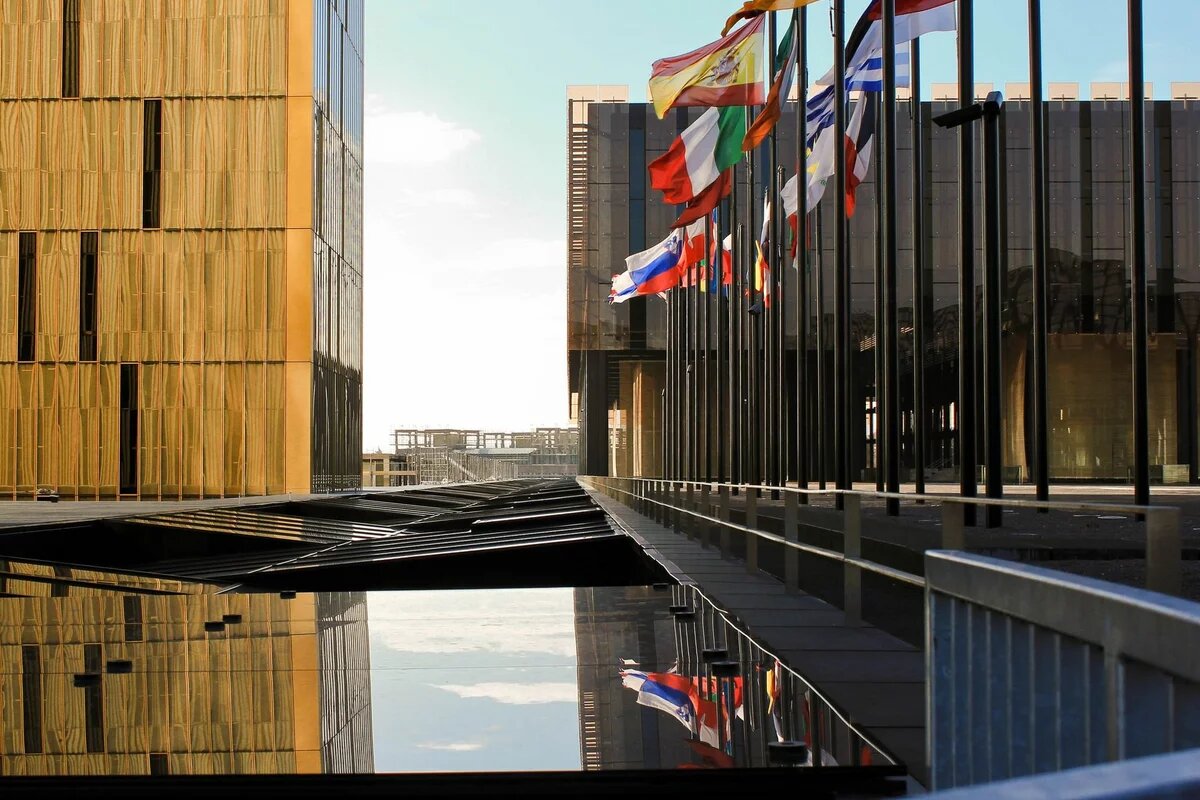
Die meisten Verfassungsjuristen/innen sind sich einig, dass die aktuellen Reformen der polnischen Regierung die Rechtsstaatlichkeit, insbesondere die Unabhängigkeit der Richterschaft unterminieren. Die meisten gehen auch davon aus, dass der gegenwärtige Abbau der Rechtstaatlichkeit den Werten der Europäischen Union widerspricht. Doch was folgt daraus?
Katz-und-Maus-Spiel zwischen EU-KOM und polnischer Regierung
Dass Mitglieder der EU an gemeinsame Werte gebunden sind, postuliert schon der zweite Artikel des EU Vertrages. Doch dem EU-Recht fehlt bisher ein effektives Instrument, um solche Verletzungen gemeinsamer Werte zu ahnden. Zwar sieht der Vertrag im Art. 7 vor, dass die Kommission mit einem begründeten Vorschlag den EU-Rat um eine Feststellung einer Gefahr der Werteverletzung ersuchen kann.
Im Falle Polens ist dies geschehen: Die Kommission hat einen solchen Vorschlag erlassen. Allerdings kann die Feststellung des EU-Rats nur mit Vier-Fünftel-Mehrheit der Stimmen aller EU-Länder erfolgen. Diese überwiegende Mehrheit gegen Polen ist gegenwärtig aus politischen Gründen nur schwer vorstellbar.
Also war die Kommission bisher auf die weichen Instrumente zwischen Drohungen und Verhandlungen angewiesen. Der zuständige Kommissar Frans Timmermanns wurde zum Dauerbesucher in Warschau. Lange Monate glich der Austausch zwischen der Europäischen Kommission und der polnischen Regierung einem Katze-und-Maus-Spiel. Die Kommission kritisierte; die Regierung wies die Kritik zurück oder unternahm kosmetische Änderungen, in der Substanz gab es kaum Bewegung.
Juristische Instrumente sind notwendig
Spätestens im Frühjahr stand fest, dass das Verfahren nach Art. 7 aufgrund politischer Interessenlage aussichtslos war. Die Aufmerksamkeit schwenkte zu juristischen Instrumenten, von denen die meisten nur dann wirksam wären, wenn sie vor dem EU –Gericht, dem EuGH landeten.
Zwei Hürden müssten zu einem wirksamen juristischen Erfolg genommen werden:
- Erstens, die Einleitung des Verfahrens darf nicht an einzelnen Mitgliedsstaaten (etwa Ungarn oder Polen selbst) scheitern.
- Zweitens, die Zuständigkeit des EuGH muss gegeben sein.
Ein kleines Fenster der Möglichkeit stellt Art. 258 des Vertrags über Arbeitsweise der EU dar, eines Vertrags, der gewissermaßen die Prozessordnung der EU ist. Hiernach kann die Kommission einen Staat vor dem EuGH „verklagen“, wenn dieser Staat Verträge der EU verletzt.
Die erste Hürde wäre somit mit Art. 258 schon genommen – das Verfahren (z.B. gegen Polen) könnte die Kommission einleiten, ohne dazu auf die EU-Länder angewiesen zu sein. Dies hat die Kommission nach erheblichem politischem Druck gegen Polen im Juni getan.
Die zweite Hürde ist prekärer. Art. 258 regelt das Verfahren nur bei Verletzungen der EU-Verträge. Die Kommission muss einen Verknüpfungspunkt zwischen Abbau der Rechtstaatlichkeit in Polen und Polens Vertragsverpflichtungen gegenüber der EU finden. Der Grund hierfür liegt in der Funktion des Europäischen Gerichtshofs. Er ist klassischerweise auf Verletzung des EU-Vertragsrechts oder Verfahren gegen EU-Organe beschränkt.
Der EuGH ist keine Superrevisionsinstanz und kein Menschenrechtsgericht – er kann nicht, ähnlich dem deutschen Bundversverfassungsgericht, aus sich heraus über Zustände oder Rechtssachen in Mitgliedsstaaten in letzter Instanz entscheiden. Es sei denn es geht um die Umsetzung oder Verletzung des Gemeinschaftsrechts der EU.
Rechtsschutz für EU-Recht muss gewährleistet sein
Aber begründen die Reformen des Justizwesens in Polen eine Verletzung der EU-Verträge?
Nirgendwo in den EU-Verträgen ist zu finden, was in Menschenrechtsverträgen immer steht: Dass Bürger ein Anrecht auf faire Verfahren und somit auf unabhängige Gerichte haben.
Unsere Hoffnungen setzen wir, die wir die Reformen kritisch betrachten, in den Art. 19 des EU-Vertrags. Dort wird beschrieben, wie das EU-Recht (und nur das EU-Recht) durchgesetzt wird. Insbesondere so:
„Die Mitgliedstaaten schaffen die erforderlichen Rechtsbehelfe, damit ein wirksamer Rechtsschutz in den vom Unionsrecht erfassten Bereichen gewährleistet ist.“
Diese Pflicht gilt nicht generell, sondern nur für die Umsetzung des EU-Rechts. Doch hier kommt der nachvollziehbare juristische Kniff zum Tragen: Schwächt ein Staat sein Justizsystem insgesamt, so kommt er auch seiner Verpflichtung aus Art. 19 des EU-Vertrags nicht nach, denn es sind meist dieselben Gerichte, die nationales und europäisches Recht sprechen. Ergo kein wirksamer Rechtsschutz für EU-Recht, ergo die Zuständigkeit des EuGH ist gegeben!
Rechtsstaatlichkeit und unabhängige Gerichte
Dieser Logik scheint der EuGH selbst nicht abgeneigt zu sein. Schon im Februar dieses Jahres sandten die EU-Richter/innen eindeutige Signale in Richtung PiS-Regierung aus. Sie hatten nämlich zu entscheiden, ob die Kürzung der Richterbezüge in Portugal gegen den erwähnten Art. 19 des EU-Vertrags verstieß.
Zwar erkannte das Gericht keine Verletzung von Art. 19 durch Portugal, hielt sich aber ungewohnt lange mit der Frage der Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Gerichte auf. Dem Leser kam es vor, als würde der EuGH zwar über den portugiesischen Rechnungshof urteilen, in Wirklichkeit aber der polnischen Regierung die Leviten lesen. Der EuGH stellte im damaligen Urteil nämlich fest, dass der effektive Rechtsschutz gemäß Art. 19 des Vertrags als allgemeiner Grundsatz des europäischen Rechts zu verstehen sei, in einer Reihe mit anderen europäischen Menschenrechtsstandards, die ein faires Verfahren, und somit nach EuGH auch die Unabhängigkeit der Richter/innen garantieren.
Polnische Justizreform im Fokus
Jetzt fiel die neuste EuGH Entscheidung. Das Gericht musste nicht mehr durch die Blume sprechen. Im Sachverhalt ging es ausdrücklich um Polen. Der irische High Court hatte sich nämlich geweigert, einen Verdächtigen nach dem sogenannten europäischen Strafbefehl an die polnischen Justizbehörden auszuliefern. Begründung – nach den polnischen Justizreformen könne keiner mehr garantieren, dass dem Verdächtigen ein fairer Prozess garantiert würde.
Die europäischen Richter/innen stimmten dem irischen Gericht zu. Nach dem Europäischen Haftbefehl ist es die Regel, dass eine Auslieferung an ein anderes EU-Mitglied unhinterfragt, ja automatisch erfolgen solle. Allerdings sehe Art. 1 Abs. 3 der Regelungen zum Europäischen Haftbefehl vor, dass Mitgliedsstaaten gegenseitige Auslieferungen nicht gegen die eigenen Menschenrechtsverpflichtungen vollziehen dürfen. Hiernach, so das Gericht, entfalle die Pflicht zur Auslieferung, wenn das „Prinzip des gegenseitigen Vertrauens“ zwischen Justizbehörden der Mitgliedsstaaten nicht funktioniert. Das bedeutet schlichtweg: Unhinterfragte Justizzusammenarbeit gibt es nur, wenn sich alle über gegenseitige demokratische Standards im Klaren sind. Ohne Vertrauen – kein Automatismus.
Wichtig für alle Kritiker von PiS-Reformen: Das Gericht buchstabiert seine Ausführungen über Rechtstaatlichkeit aus dem Urteil gegen Portugal weiter aus. Es mahnt klare verlässliche Regeln für die Ernennung, die Amtsdauer, die Gründe für Ablehnung und Abberufung der Richter an, die jeden Zweifel an Parteilichkeit der Gerichte ausräumen sollen. Ausdrücklich beschäftigt sich der EuGH auch mit Disziplinarverfahren als Mittel der Maßregelung gegen Richter – allesamt maßgebliche Kritikpunkte an den polnischen Reformen.
Diese neuste Entscheidung des EuGH wurde wegen der ausdrücklichen Befassung mit Zuständen in Polen von den Reformkritikern gefeiert. Die Ausführungen dürften als zweiter Warnschuss des EuGH an die Adresse der polnischen Regierung interpretiert werden. Für viele gilt dieses Urteil als Hoffnungsschimmer bezüglich der Rolle, die der EuGH bereit ist, im Streit um die Zukunft der polnischen Justiz einzunehmen.
Reformen für die Rechtsstaatlichkeit als Hauptbestandteil der EU
Allerdings wird ein wichtiger Aspekt außer Acht gelassen: Der EuGH hat die Rolle des politischen (!) Verfahrens gemäß Art. 7 hervorgehoben, was Anlass zur Sorge ist. Für den Bereich des europäischen Haftbefehls betont der Gerichtshof nämlich, dass die Ablehnung der Auslieferung nach Polen nicht pauschal erfolgen kann. Für eine solche pauschale Ablehnung fehle es an einem Beschluss des EU-Rates gemäß Art. 7 des EU-Vertrags. Der EuGH besteht darauf, dass, solange dies der Fall sei, ein Auslieferungsstopp nur dann zulässig sei, wenn eine konkrete und echte Gefahr für die Rechte der betroffenen Person nachweisbar sei.
Dies bestätigt den Verdacht, dass im laufenden Vertragsverletzungsverfahren, in dem es generell um Justizreformen in Polen geht, der EuGH auf das nicht abgeschlossene politische Verfahren gemäß Art. 7 verweisen könnte, um sich elegant aus der Affäre zu ziehen. Allzu groß wäre die Sorge der EU-Richter/innen, dass der EuGH als „aktionistisches Gericht“ von populistischen Kritiker/innen angegriffen wird, viel zu groß die Wahrscheinlichkeit, dass Polen dem Urteil des EuGH schlichtweg nicht Folge leisten würde. Um dies zu vermeiden, könnte der EuGH auf den Vorrang des politischen Verfahrens gemäß Art. 7 verweisen und das juristische Verfahren ruhen lassen oder zum Scheitern bringen. Jedenfalls hat sich der EuGH nach dem neusten Urteil für diesen Rückzug aus dem Gefecht einen Türspalt offengelassen.
Aus dieser Situation müssen wir grundsätzliche Schlussfolgerungen ziehen: Wir brauchen EU-Reformen, die Rechtsstaatlichkeit nicht als Nebenprodukt, sondern als Hauptbestandteil der EU positionieren. Dazu gehört auch die Aufwertung der Rolle des EuGH: Weg von einer reinen Vertragsüberwachung, hin zu einem Gericht, welches mehr Mitsprache bei wirklich wichtigen Fragen des Rechtssystems und der Bürgerrechte bekommt. Es ist Zeit für eine nachhaltige und holistische Strategie zum Schutz der Rechtstaatlichkeit in der EU.